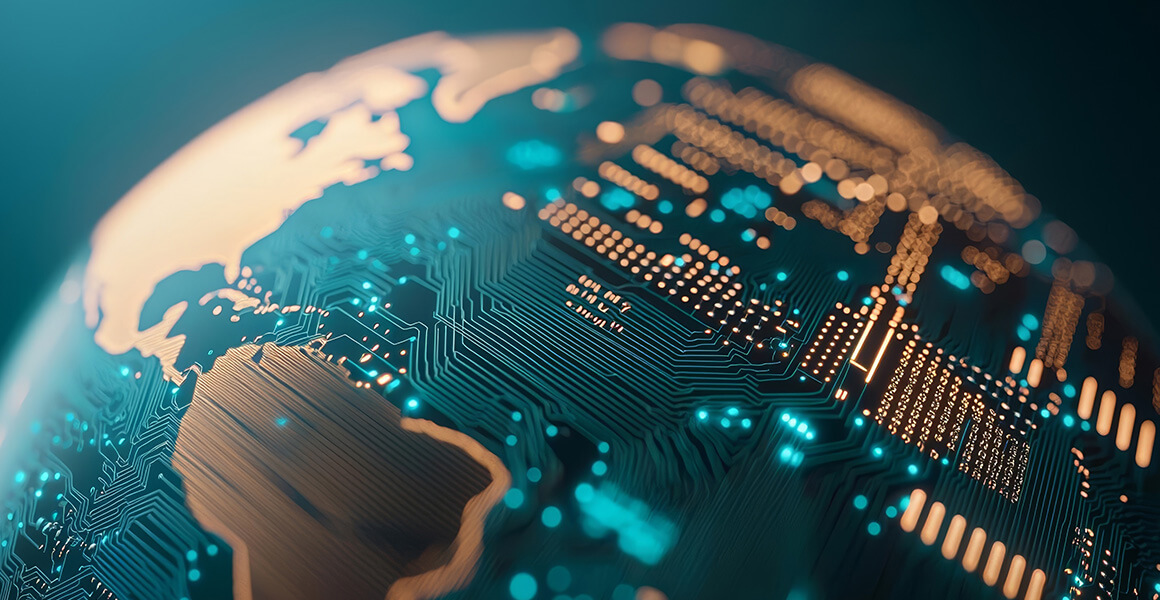Digitale Souveränität verstehen
Digitale Abhängigkeiten werden für Unternehmen zunehmend zum strategischen Risiko. Politische Konflikte, gesetzliche Zugriffsrechte und proprietäre Technologien können dazu führen, dass kritische Systeme plötzlich nicht mehr verfügbar sind – oder Daten fremden Rechtsräumen unterliegen. Der US CLOUD Act etwa ermöglicht amerikanischen Behörden Zugriff auf Daten von US-Anbietern, unabhängig vom physischen Speicherort. Für Organisationen bedeutet das: Kontrollverlust und eingeschränkte Handlungsfähigkeit im Ernstfall.
Digitale Souveränität gewinnt daher an Bedeutung – nicht als technisches Schlagwort, sondern als Voraussetzung für langfristige Resilienz.
Was digitale Souveränität ausmacht
Digitale Souveränität bedeutet, jederzeit selbstbestimmt über die eigenen Daten, Systeme und Technologien entscheiden zu können. Zentral ist nicht Abschottung, sondern Wahlfreiheit: externe Dienste können genutzt werden, aber auf Basis transparenter, kontrollierbarer Rahmenbedingungen.
Abhängigkeiten entstehen häufig durch proprietäre Schnittstellen, geringe Portabilität oder die Bindung an bestimmte Rechtsräume. Fällt ein Anbieter aus, ändert seine APIs oder gerät in politische Auseinandersetzungen, können zentrale Geschäftsprozesse beeinträchtigt werden. Die Eidgenössische Finanzkontrolle weist deshalb explizit darauf hin, dass Cloud-Abhängigkeiten die Verfügbarkeit von Daten und Anwendungen gefährden können.
Souveränitäts-Washing: lokale Labels genügen nicht
Mit der steigenden Nachfrage nach „souveränen“ Lösungen wächst auch die Zahl der Angebote, die den Begriff zwar verwenden, aber die zugrundeliegenden Anforderungen nicht erfüllen. Rechenzentren in Europa, Daten-Treuhänder oder Partnerschaften mit lokalen Unternehmen schaffen zwar Nähe, lösen jedoch nicht alle Herausforderungen.
Das deutsche Zentrum für Digitale Souveränität (ZenDiS) warnt vor „Souveränitäts-Washing“: Lösungen, die europäische Datenhaltung versprechen, aber weiterhin auf proprietäre Technologien, eingeschränkte Portabilität oder ausländische Rechtsräume angewiesen sind.
Echte digitale Souveränität erfordert:
- Offene Schnittstellen und Standards
- Nachweisbare Wechselfähigkeit ohne Betriebsrisiko
- Volle Daten- und Schlüsselkontrolle
- Transparenz über den Code
Ein europäisches Label ersetzt diese Kriterien nicht.
Open Source als Basis echter Unabhängigkeit
Open Source ist ein Schlüsselfaktor für digitale Souveränität. Transparenter Quellcode und offene Standards vermeiden Lock-ins, erhöhen Interoperabilität und ermöglichen unabhängige Sicherheitsprüfungen.
Mehrere öffentliche Einrichtungen verfolgen diesen Ansatz bereits:
- Schleswig-Holstein migriert Verwaltungsstrukturen in Richtung Open Source und setzt auf offene Schnittstellen sowie Multi-Vendor-Modelle.
- In der Schweiz stärkt die Erneuerung des EMBAG die Priorisierung offener Technologien.
- Das Netzwerk „Souveräne Digitale Schweiz“ vernetzt Akteure, um digitale Eigenständigkeit zu fördern.
Wichtig ist dabei ein realistisches Verständnis moderner Open-Source-Ökosysteme: Heute agieren professionelle Dienstleister mit klaren Support- und Weiterentwicklungsmodellen. Organisationen können Funktionen mitgestalten und erhalten Transparenz über die technologische Basis ihrer Systeme.
Fünf Schritte zu mehr digitaler Souveränität
Unternehmen können ihre Souveränität bereits mit überschaubarem Aufwand stärken:
- Abhängigkeiten analysieren
Welche kritischen Systeme hängen von welchen Anbietern, Technologien oder Rechtsräumen ab? - Offene Standards nutzen
Proprietäre Formate vermeiden und Schnittstellen einsetzen, die Interoperabilität sicherstellen. - Multi-Vendor-Strategien etablieren
Redundanz aufbauen, um Ausfälle einzelner Anbieter abzufedern. - Datenhoheit sicherstellen
Sensible Daten konsequent verschlüsseln und Schlüssel intern verwalten. - Exit-Szenarien testen
Regelmässig prüfen, wie Dienste ersetzt oder migriert werden können, falls sie kurzfristig entfallen.
Fazit
Digitale Souveränität ist kein politisches Konzept, sondern ein betriebswirtschaftlicher Erfolgsfaktor. Sie schafft Resilienz und ermöglicht es Organisationen, flexibel auf Veränderungen zu reagieren – gerade in Zeiten geopolitischer Unsicherheit und dynamischer Technologiemärkte.
Wer seine Abhängigkeiten kennt, offene Technologien einsetzt und Alternativen vorbereitet, stärkt nicht nur die eigene digitale Unabhängigkeit, sondern auch die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.
Dieser Artikel basiert auf der September-Ausgabe unserer Kolumne „Schlicht und einfach“ im Magazin Inside IT. Der Originaltext stammt von Markus Schlichting, CEO von Karakun, der sich in der Kolumne regelmässig mit technologischen Grundsatzfragen und ihrer praktischen Bedeutung für Unternehmen beschäftigt.
Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Abhängigkeiten erkennen, souveräne Architekturen aufbauen oder Open-Source-Strategien sinnvoll einführen können, sprechen Sie uns gerne an. Wir unterstützen Organisationen dabei, nachhaltige und unabhängige digitale Lösungen zu gestalten.
FAQ
Was ist digitale Souveränität?
Digitale Souveränität bedeutet, jederzeit selbstbestimmt über Daten, Systeme und Technologien entscheiden zu können – unabhängig von einzelnen Anbietern oder externen politischen Vorgaben.
Warum ist digitale Souveränität für Unternehmen wichtig?
Weil Abhängigkeiten zu Kontrollverlust, Betriebsunterbrüchen und rechtlichen Risiken führen können. Organisationen bleiben handlungsfähig, wenn sie ihre IT-Architektur souverän gestalten.
Wie erreicht man digitale Souveränität?
Durch offene Standards, Multi-Vendor-Strategien, Verschlüsselung mit eigenen Schlüsseln und regelmässig getestete Exit-Szenarien.
Was versteht man unter „Souveränitäts-Washing“?
Dienste, die zwar als „souverän“ vermarktet werden, aber zentrale Anforderungen – wie Wechselfähigkeit, offene Schnittstellen oder Datenhoheit – nicht erfüllen.
Welche Rolle spielt Open Source für digitale Souveränität?
Open Source verhindert Lock-ins, schafft Transparenz und ermöglicht unabhängige Sicherheitsprüfungen. Es ist ein zentraler Baustein souveräner IT-Architekturen.